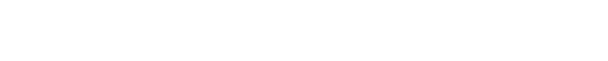
»Es begann ziemlich zufällig. Wir eröffneten in der Shell Bar von Henry J. Kaisers Hawaiian Village im Jahr 1956. [...] Das Hawaiian Village hatte eine wunderbare open-air Tropenkulisse. Es gab einen Teich mit einigen sehr großen Ochsenfröschen direkt neben der Bühne. Eines abends spielten wir einen bestimmten Song und ich konnte hören, wie die Frösche anfingen mit [tiefe Stimme] »Quak! Quak! Quak!«. Als wir aufhörten zu spielen, hörten die Frösche auf zu quaken. Ich dachte, »Hmm - ist das Zufall?« Und etwas später sagte ich, »Laßt uns diese Melodie noch einmal spielen«, und prompt quakten die Frösche wieder los. Zum Spaß fingen einige von den Jungs mit diesen Vogelschreien an. Hinterher schüttelten wir uns aus vor Lachen: »Hey, das hat echt Spaß gemacht!« Doch am nächsten Tag kam einer von den Gästen auf mich zu und sagte: »Mr. Denny, wissen Sie, dieser Song, den Sie gespielt haben, den mit den Vögeln und den Fröschen? Können Sie den noch mal spielen?« Ich sagte, »Von was reden Sie?« - und dann dämmerte mir, daß er dachte, das sei Teil des Arrangements.Bei der nächsten Probe sagte ich, »Okay, Jungs, wie wär's, wenn jeder von euch einen anderen Vogelruf macht? Ich mache den Frosch...« (Ich hatte diese eingekerbte zylindrische Gourd, die Guïro genannt wird, und wenn man das an das an ein Mikrophon hielt und mit einem Stift über die Kerben schrapte, klang es wie ein Frosch). Wir spielte es am nächsten Abend, und die ganze Zeit über kamen die Leute und sagten, »Wir wollen das mit den Fröschen und Vögeln noch einmal hören!« Wir müssen das Stück dreißig mal gespielt habe. Das wurde dann »Quiet Village.««1
Bevor ich mich jedoch an der Frage abarbeiten werde, was die gesellschaftlichen Ursachen sind, die dem musikalischen Exotismus zu Grunde liegen, möchte ich zunächst ganz allgemein eine Typologie der musikalischen und außermusikalischen Mittel entwickeln, die verwendet werden, um einem Musikstück den erwünschten exotischen Touch zu geben.
Die im folgenden aufgeführten Mittel zur »Exotisierung« von Musik bedienen durchaus unterschiedliche Grade des Exotismus-Bedürfnisses. Ich habe versucht, diese Mittel so anzuordnen, daß sie eine aufsteigende Linie bilden. Interessant ist dabei vor allem, daß es sich eigentlich um sehr wenige musikalische Mittel handelt. Tatsächlich lassen sich gerade einmal fünf verschiedene Strategien unterscheiden, die benutzt werden, um ein Musikstück in ein Exotica-Stück zu verwandeln. Und dabei überlappen sich diese Strategien zudem noch großzügig. Es sind dies:
Der exotistische Text ist sicherlich das schwächste Mittel, um einem ganz normalen Stück einen exotischen Anstrich zu geben. Vor allem im Deutschland der Nachkriegszeit war dies das probate Mittel, die Sehnsucht nach dem Fremden zu stillen. Klassisches Beispiel hierfür sind die legendären Capri-Fischer:
»Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt,
und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt,
zieh'n die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus,
und sie werfen im weiten Bogen die Netze aus.Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament,
ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt,
und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt,
hör von fern, wie es singt:Bella, bella, bella, bella Marie,
bleib' mir treu, ich komm' zurück morgen früh'.
Bella, bella, bella, bella Marie,
vergiß' mich nie.«
Doch von dieser zeitgeschichtlichen Einordnung einmal abgesehen: Musikalisch erinnern die Capri-Fischer selbst beim besten Willen nicht an Italien. Wenn hier musikalischer Exotismus vorliegt, dann bestenfalls im Rhythmus, und dieser Rhythmus hat nun wieder gar nichts Italienisches, sondern ist an einen Sambarhythmus angelehnt. Zum Italienschlager wird das Stück allein durch den Text mit seinen durchaus plastischen, wenn auch völlig realitätsfernen Bildern. Und auf diese Art und Weise operieren eine große Zahl der Exotik-Schlager in Deutschland bis in die 60er Jahre hinein. Schon 1947, als die meisten Menschen in Deutschland kaum etwas zu beißen hatte, forderten UNDINE VON MEDVEY und PETER REBHUHN die Deutschen auf: Komm mit mir nach Tahiti. Je größer offensichtlich die Diskrepanz zwischen der erfahrenen Realität und den Träumen von fernen Ländern waren, um so besser funktionierten offensichtlich derartige exotistische Billigangebote.
Ähnlich platt ist das Verhältnis des Hörers zum Schlagerexotismus in der Figur des »fremdländischen Interpreten« ausgebildet. Auch hier findet sich das Deutschland der Nachkriegs in der Vorreiterrolle. Schaut man sich die bestverkauftesten deutschen Schlager der frühen 60er Jahre an, findet man eine beinahe unglaubliche Häufung von nicht-deutschen Interpreten. Stammten 1959 von den 20 bestverkauften Schlagern in Deutschland immerhin schon ein Viertel von ausländische Interpreten (wobei wir Österreicher und Schweizer großzügig zu den Deutschen rechnen), waren es 1962 bereits mehr als die Hälfte: 11 von 20. Und selbst die deutschen Interpreten schmückten sich mit ausländischen Namen. So hießen GITTA LIND und CHRISTA WILLIAMS, die 1959 mit dem Titel My Happiness sehr erfolgreich waren, mit bürgerlichen Namen Rita Maria Gracher respektive Rita Maria Braun.2
Tatsächlich ist gerade in Deutschland eine hochgradige Ambivalenz gegenüber dem Exotismus in der einheimischen Schlagerproduktion festzustellen. Das Bedürfnis, den »Ausländer« singen zu hören, korrespondiert gleichzeitig mit dem mindestens ebenso starken Bedürfnis, dem singenden »Ausländer« die, wie es heute heißen würde, »deutsche Leitkultur« aufzuzwingen. Die ausländischen Schlagersänger, die in Deutschland Erfolg haben wollten, mußten möglichst unexotisch auftreten. Daß sie in deutscher Sprache sangen, verstand sich sowieso von selbst. Aber auch jeder fremdländische Akzent mußte auf ein bares Minimum herabgedrückt werden. Man muß sich hierfür nur die Platten der BLUE DIAMONDS anhören.
Zwei der fünf Strategien des musikalischen Exotismus sind damit abgehandelt, noch bevor wir überhaupt zur Musik gekommen sind. Was jetzt als erstes genuin musikalisches Mittel auftaucht, ist selbstverständlich der Rhythmus. Insbesondere lateinamerikanische Rhythmen hatten schon um die Zeit des ersten Weltkriegs die Populärmusik - und in deren Gefolge dann auch Teile der sogenannten »ernsten« Musik - im Sturm erobert.
Wirklich exotisch sind diese Rhythmen selbstverständlich nicht. In der Regel beschränkt sich der exotisch wirkende Rhythmus darauf, die Betonungen im klassischen Vier-Viertel-Takt, der wie selbstverständlich als starres, der Musik unterlegtes Raster angenommen wird, zu verschieben. Schon Adorno hatte 1936 in seiner zu Unrecht viel geschmähten Kritik am Jazz zutreffend bemerkt:
»Bei all diesen Synkopierungen indessen, die in virtuosen Stücken zuweilen als ungemein kompliziert sich geben, ist die zugrundeliegende Zählzeit aufs strengste innegehalten; sie wird je und je von der großen Trommel markiert. Die rhythmischen Ereignisse betreffen die Akzentuierung, doch nicht den Zeitverlauf des Stückes, und selbst die Akzentuierung bleibt, eben durch die grosse Trommel und die ihr zugeordneten Continuo-Instrumente, stets auf eine zugrundeliegende symmetrische bezogen. So ist denn insbesondere in der »Grossrhythmik« die Symmetrie völlig respektiert.«3Hinzukommt, daß uns heute die so synkopierten Rhythmen der lateinamerikanischen Tanzmusik und dann später des Jazz so in Fleisch und Blut übergegangen sind, daß sie kaum mehr sonderlich exotisch wirken. Vielmehr gehören sie zum ganz normalen Handwerkszeug eines jeden Interpreten populärer Musik, kommt diese nun im Mantel des Exotismus einher oder auch nicht.
Die exotistische Aufladung des Rhythmus erfolgt deshalb auch konsequenterweise nicht auf der Ebene des Rhythmus selbst - wirklich »exotische« Rhythmen sind eine absolute Seltenheit - sondern viel häufiger über den Exotismus der Instrumente, die zur Erzeugung des Rhythmus verwendet werden. MARTIN DENNY, der König der Exotica-Musik, beschreibt das Verfahren sehr genau:
»Es ist doch so, wenn man einen Kuchen backt und dabei einfallsreich sein will, dann macht man am besten etwas, das wie Applepie schmeckt, aber mit einer Spur Mango darin...Tatsächlich ist eine Menge von dem, was ich mache, ein Aufmotzen bekannter Melodien. Ich kann eine Melodie wie »Flamingo« nehmen und ihr durch meinen Stil einen tropischen Anstrich geben. [...] Wir haben jeden Song durch ein anderes ethnisches Instrument unterschieden, normalerweise auf einem halb-jazzigen oder lateinamerikanischen Rhythmus. Obwohl es so bekannt blieb, erhielt jeder Song einen fremdartigen, exotischen Charakter.«4
Hier überlappen sich zwei Mittel zur »Exotisierung« eines Musikstücks: Rhythmus und ungewöhnliche Instrumentierung. Wie die relative rhythmische Armut vieler exotischer Stücke durch die Verwendung unbekannter Perkussionsinstrumente cachiert wird, so oft genug auch ihre melodische oder harmonische Dürftigkeit. Noch die Verwendung der Sitar bei den BEATLES stellt ein Echo dieser Suche nach exotischen Instrumenten Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre dar.
Diese Suche nach exotischen Klängen führte dann auch zu einem recht merkwürdigen Paradoxon: Zur Klangerzeugung wurden nicht nur aus allen Erdteilen zusammengetragene sogenannte »ethnische« Instrumente verwendet, sondern auch die modernsten Methoden der elektronischen Klangerzeugung und -verfremdung. Ein ganz wichtiges Instrument in diesem Bereich war das Theremin. Das Instrument selbst war bereits 1920 von einem Russen, Leon Theremin, erfunden worden. Beim Spielen wird das Instrument nicht berührt, sondern Tonhöhe und -stärke werden durch Handbewegungen vor zwei Antennen gesteuert, was bizarre, »außerirdische« Klänge erlaubt.
»Wie der wahnsinnige Wissenschaftler in seinem Laboratorium arbeitete Paul monatelang im Geheimen und entwickelte ein Mehrspur-Aufnahmesystem, das es ihm erlaubte, seine Tonspuren übereinander zu legen, so daß die Gitarre wie zunächst zwei, dann drei Gitarren klang. Unermüdlich experimentierte er mit Bändern, so daß er in der Lage war, den Klang seiner Gitarre zu beschleunigen, abzubremsen, wie ein Gummiband zu dehnen. Die Gitarre hallte und zitterte mit Echo. Das endgültige Resultat monatelangen Experimentierens war eine Version des Rodgers und Hart Standards »Lover«, der klang, als hätte eine Bande Spaßvögel vom Mars ihn im Weltraum aufgenommen.«5
In diesem Bereich verschmelzen zwei einander scheinbar diametral entgegengesetzte Bereiche: Den Klangexperimenten mit exotischen, ja archaischen Instrumenten, die aus allen Erdteilen zusammengetragen wurden, entsprach eine ebenso ausgeprägte Experimentierwut in den Studios. Mit allen möglichen Tricks wurde in den Studios versucht, den Klang der Aufnahmen seltsam, fremd und aufregend klingen zu lassen.
Die technische Revolution des Aufnahmestudios und der Einsatz elektronischer Musikinstrumente ermöglichten völlig neue Klangerfahrungen, die sich durchaus mit den Klängen des Exotismus vertrugen. Ob die Musik ein imaginäres Hawaii oder die Musik der Marsianer evozierte, war herzlich egal. Das Theremin-Musikbeispiel vorhin stammte vom Debut-Album eines der profiliertesten Exotica-Komponisten und Interpreten, LES BAXTER. BAXTER - aus dessen Feder auch MARTIN DENNYs Hit Quit Village stammte - experimentierte von Anfang an mit den Möglichkeiten elektronischer Klangerzeugung. Auch als der Moog-Synthesizer auf den Markt kam, war BAXTER einer der ersten, der das Instrument einsetzte.
Kurz und gut: Klangliche Sensationen durch ungewöhnliche Instrumentierungen und überraschende Studioeffekte sind zweifellos ein ganz wesentlicher Bestandteil des musikalischen Exotismus.
Es bleibt ein letztes Element des musikalischen Exotismus, der Einsatz ungewöhnlicher Skalen. Gemeint ist damit, daß in der Melodielinie des entsprechenden exotistischen Musikstückes statt der üblichen Dur- oder Moll-Skala eine wie auch immer geartete »exotische« Skala verwendet. In der Regel zeichnen sich derartige exotische Skalen durch ein Übermaß an kleinen Sekundschritten aus.
Typisches Beispiel hierfür ist etwa der Surfklassiker Misirlou. Dieses Stück gilt inzwischen in der Version von DICK DALE, insbesondere nachdem QUENTIN TARANTINO es als Titelmusik für seinen Film Pulp Fiction eingesetzt hatte, als Synonym für Surfmusik schlechthin. Dabei hatte Misirlou 1962, als es von Dick Dale eingespielt wurde, bereits rund ein Vierteljahrhundert und unzählige Einspielungen auf dem Buckel.
Bei dieser Skala handelt es sich um eine modifizierte Variante eine Kirchentonart, nämlich der phrygischen Skala. Indem die kleine Terz der eigentlichen Phrygischen Skala durch eine große Terz ersetzt wird, ergibt sich die sogenannte Phrygisch-Dur Skala6. Durch diese Erhöhung der Terz erhält man eine Skala mit drei kleinen und einem übermäßigen Sekundschritt, die außerordentlich orientalisch anmutet:
Hier könnte man nun tatsächlich einen tiefergehenden Bruch zur ansonsten zum recht konventionellen Aufbau von Popmusik vermuten. Während die bislang aufgeführten Stilmittel dem Ganzen der Stücke in den allermeisten Fällen ziemlich äußerlich bleibt, wird hier scheinbar recht tief in die Ordnung des Tonmaterials eingegriffen. Doch diese Vermutung trügt. Dies wäre dann der Fall, wenn die Harmonien eines derartigen Stückes konsequent dem Skalenaufbau folgen würde. Doch das ist nicht der Fall. Die exotische Skala spielt nur in der Melodiestimme eine Rolle, während sie die harmonische Faktur derartiger Stücke kaum berührt. Harmonisiert wird in klassischen Dur-Moll-Akkorden, deren Verbindung den üblichen Regeln folgt. Die zahllosen dissonanten Akkorde, die sich aus dem durch die Melodielinie umrissenen Klangraum ergeben würden, bleiben außen vor. Die Exotik bleibt auf die Horizontale, die Melodieführung beschränkt, während in der Vertikalen, den Harmonien, die Ordnung des abendländischen Tonraums unangetastet bleibt.
Wenn wir diese Elemente des musikalischen Exotismus nun zusammenfassen, können wir konstatieren, daß es mit dem Exotischen beim musikalischen Exotismus gar nicht so sehr weit her ist. MARTIN DENNYs Vergleich mit dem Apfelkuchen, dem man eine Prise Mango hinzufügt gilt nicht nur für die Instrumentierung, sondern für alle Elemente des musikalischen Exotismus: Im Grunde bleibt man beim Altvertrauten, das nur ein wenig aufgepeppt wird, damit es aufregend-fremdartig erscheint, ohne sich jedoch der Gefahr auszusetzen, sich tatsächlich mit etwas wirklich Fremdem konfrontiert zu sehen.
Das heißt nun nicht, daß die Musik schlecht sein muß. Ein guter Apfelkuchen ist etwas Feines, und wenn ihm dann noch eine Spur Mango hinzugefügt wird, ist er möglicherweise superb. Doch wir müssen diese weitgehende Äußerlichkeit der exotistischen musikalischen Mittel im Hinterkopf behalten, wenn wir uns nun der Ursachenforschung zuwenden.
Stellen wir also die Frage: Woher kam diese Sehnsucht nach dem Fremdländischen, Exotischen, das gerade in den fünfziger Jahren ein Instrumentalstück wie Quiet Village die Hitparaden stürmen ließ? Als eine Erklärung hierfür wird gerne die Langeweile angeführt, die die fünfziger Jahre angeblich prägte. Hier ein x-beliebiges herausgegriffenes Beispiel aus den Linernotes zur Wiederveröffentlichung einer KORLA PANDIT-Platte:
»Südkalifornien unterschied sich nicht sonderlich vom restlichen Amerika während des ersten Jahrzehnts nach dem zweiten Weltkrieg - es war wohlhabend und mehr als nur ein bißchen langweilig. Die Männer kehrten aus dem Krieg zurück, heirateten, bekamen Kinder und fanden Arbeit in den neuen Fabriken. In den South Bay Vorstädten von Los Angeles wie Hawthorne (der Heimat der Beach Boys) und Downey (wo die Carpenters und die Blasters herkamen) war der dominierende Architekturstil das Reihenhaus.Das klingt als Erklärung zwar ganz nett, reicht aber bei weitem nicht aus, um das Phänomen des musikalischen Exotismus zu erklären. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß auch in Deutschland, wenn auch mit den bereits angedeuteten Differenzen, die Musik mit Hilfe der Exotik-Masche verkauft wurde. Die geographische Einschränkung auf die USA greift deutlich zu kurz, weshalb auch der schon früher angeführte Verweis auf Hawaii daneben liegt. Und nicht nur die geographische, sondern auch die zeitliche Beschränkung auf die 50er und 60er Jahre ist mehr als trügerisch.Und so war die Bühne für ein bißchen Showbusiness vorbereitet, um Amerika aus seinen Lähmung herauszuziehen. Die Phantasie wurde Wort, James Micheners Tales of the South Pacific wurde zum Bestseller, der das nationale Bewußtsein beherrschte. Hier wurde eine polynesische Phantasiewelt geboten - Grasröckchen, Tikis, wunderschöne Eingeborenenmädchen. [...] Micheners Buchhit (der kurz darauf als Vorlage für ein Rogers und Hammerstein Musical diente), entflammte die Phantasien, die die Amerikaner so verzweifelt benötigten. Wir hatten Jobs, Geld und Optimismus. Aber die Reihenhäuser waren abstoßend und die Fabrikarbeit war (damals wie heute) eindeutig verblödend.«7
Schaut man nämlich genauer hin, wird man feststellen, daß musikalischer Exotismus eine konstante Begleiterscheinung der abendländischen Musik ist. Man kann hier tatsächlich bis auf die Anfänge der mehrstimmigen abendländischen Musik zurückgehen. Einem der Stammväter der abendländischen Musik, JOSQUIN DES PRèS (ca. 1440 bis 1521), wird eines der ersten Exotikastücke überhaupt, La Spagna, zugeschrieben, das vom 15. bis ins 17. Jahrhundert in immer neuen Variationen bearbeitet wurde.8 Auch das 18. und 19. Jahrhundert geizen nicht Exotismen, stellvertretend seien hier nur MOZARTS Rondo alla turca oder BRAHMS' Ungarische Tänze erwähnt.
Diese Allgegenwart des Exotismus in der Musik wirft deshalb zwei voneinander zu unterscheidende Fragen auf. Die eine Frage ist die, worauf überhaupt dieser Drang zum musikalischen Exotismus beruht. Und die andere, warum gerade Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre eine derartige Häufung musikalischer Exotismen auftritt.
Die zweite Frage läßt sich leichter beantworten. Wenn wir erst einmal unterstellen, daß es ein grundsätzliches Bedürfnis nach musikalischem Exotismus gibt, auch wenn wir noch nicht sagen können, worauf dieses Bedürfnis gründet, dann wird relativ schnell klar, warum ab Mitte der 50er Jahre ein Übermaß an Exotismus aufblühte. Die Antwort ist, denke ich, ganz banal ökonomisch-technologisch. Das deutsche Wirtschaftswunder ebenso wie die US-amerikanische Prosperität nach dem Koreakrieg führte zu einer Explosion des Unterhaltungselektronik-Sektors.
An allererster Stelle ist hier natürlich das Fernsehen zu nennen. Für den musikalischen Exotismus hatte das Fernsehen zwei Funktionen, eine direkte und eine indirekte. Zunächst einmal konnte das Fernsehen, im Gegensatz zum Radio, auch die äußere Erscheinung der Musiker transportieren. Und bei der Typologie der Element des musikalischen Exotismus hatte ich bereits auf die Wichtigkeit des äußeren Erscheinungsbildes hingewiesen.
Eines der besten Beispiele hierfür ist KORLA PANDIT. PANDIT war ein Star des frühen amerikanischen Schwarz-Weiß-Fernsehens gewesen. Ein spätes Denkmal hat ihm übrigens, dies nur nebenbei bemerkt TIM BURTON gesetzt, in dessen Hommage an den schlechtesten Regisseur aller Zeiten, Ed Wood, PANDIT einen Kurzauftritt als er selbst hat. PANDITS eigene Fernsehshow lief zwischen 1949 und 1965. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität wurde sie täglich ausgestrahlt und dauerte eineinhalb Stunden. Der Ablauf war stereotyp: PANDIT, der zwar in Indien geboren wurde, aber hauptsächlich in England und den USA aufwuchs, erschien, in indische Gewänder gekleidet und mit einem Turban auf dem Kopf, setzte sich an seine Hammond-Orgel und spielte dann die gesamte zur Verfügung stehende Zeit. In der ganzen Show wurde kein einziges Wort gesprochen, man sah nur den geheimnisvoll lächelnden und Orgel spielenden PANDIT, während im Hintergrund Wolken oder Berglandschaften oder exotische Tänzerinnen projiziert wurden.
Im Zeitalter des Fernsehens genügt es eben nicht mehr, gute oder zumindest den Publikumsgeschmack treffende Musik zu machen, sondern die Musik mußte nun auch optische Sensationen bieten. Und dafür war der Exotismus natürlich ausgezeichnet geeignet.
Die zweite wichtige Veränderung, die das Fernsehen nach sich zog, war die Verlagerung der Freizeit heraus aus dem öffentlichen Raum in den privaten. Das typische Wochenendvergnügen mit Kinobesuch und anschließendem Besuch eines Tanzlokals begann zu erodieren. Spätestens in den 60er Jahren wird dies zu einer reinen Domäne der Jugendlichen, die über keine eigenen vier Wände verfügen, während die Erwachsenen ihre Freizeit in Wohnzimmern, Partykellern oder dem heimischen Garten verbringen. Diese Erosion der öffentlichen Unterhaltung ist natürlich nicht nur eine Reaktion auf das Fernsehen. Eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielt das Eigenheim oder zumindest eine ausreichend große Mietwohnung, die ein partytaugliches Wohnzimmer aufweist. Und natürlich als drittes das Komplement zum Fernseher, die HiFi-Stereoanlage.
Und so wie das Fernsehen nach optischen Sensationen gierte, so die HiFi-Anlage nach akustischen. Dies läßt sich kaum schlagender illustrieren als mit dem Werbetext einer unzähligen damals erschienen Stereo-Langspielplatten:
»Akustische Sensationen in den vier Wänden daheim. Gäste staunen, Nachbarn versinken in dumpfes Brüten. Ein völlig neues Ohrengefühl: Musik bewegt sich mitten im Raum!Auch hier bot sich musikalischer Exotismus als ausgezeichnete Quelle an, um den frischgebackenen Besitzern einer HiFi-Stereoanlage die erwünschten akustischen Sensationen ins Haus zu liefern.Geigentöne schwirren vorüber wie bunte Vögel. Bässe rumsen rechtsraus. Bläserakkorde klappen auf wie Fächer, Rhythmen springen elastisch hin und her wie frischgekaufte Tennisbälle. Wir haben nicht nur den Musikern, sondern auch den Toningenieuren am elektronischen Mischpult das »Spielen« erlaubt. Freudig nutzten sie ihre Chance. Sie schufen plastische Klangerlebnisse ersten Rangs. Sie spielten »Stereo extrem«. Alle Möglichkeiten der modernen stereophonischen Aufnahme- und Wiedergabetechnik wurden eingesetzt. Testen Sie Ihr Gerät mit dieser Super-Stereo-LP. Zeigen Sie Ihren Gästen daheim: DAS ist Stereophonie!«9
Es ist somit die Trennung einer jugendlichen Tanzkultur von einer erwachsenen Wohnzimmerkultur, die einerseits durch die ökonomische Prosperität, andererseits durch die technische Weiterentwicklung der Unterhaltungselektronik, dem musikalischen Exotismus einen Höhepunkt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre bescherte.
Deutlich schwieriger zu beantworten ist die Frage danach, wo überhaupt dieses allgemeine Bedürfnis nach musikalischem Exotismus herrührt. Offensichtlich läßt sich der musikalische Exotismus bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Und im zwanzigsten Jahrhundert wurde er offensichtlich sogar von einer musikalischen Marginalie zu einem ganz zentralen Element der Populärkultur. Das verblüfft natürlich umso mehr, als das zwanzigste Jahrhundert sich gleichzeitig als eines erwiesen hat, das den rassistischen Ausschluß alles Fremden in mörderische Extreme getrieben hat. Offensichtlich scheint hier eine hochgradige Ambivalenz vorzuliegen, der ich im folgenden nachgehenden will. Dazu verlasse ich jetzt für einige Zeit den Bereich der Musik; ich will versuchen, mit Hilfe einiger Hypothesen aus der Psychoanalyse das Verhältnis des Fremden zur Kultur näher zu bestimmen.
Um ganz allgemein anzufangen: Menschen leben immer in Gemeinschaft; und damit das gesellschaftliche Zusammenleben funktionieren kann, müssen bestimmte Regeln existieren, auf die sich der Einzelne im gesellschaftlichen Zusammenhalt einigermaßen verlassen kann.
Zwei Triebe sind es, die nach FREUD reguliert werden müssen, damit so etwas wie menschliche Gesellschaft funktionieren kann, einerseits der Sexualtrieb und andererseits eine ursprüngliche menschliche Neigung zur Aggressivität gegenüber den Mitmenschen. Als Mittel, diese Neigungen einzuschränken, bestimmt FREUD die Kultur, die aber aufgrund dieser Aufgabe in eine sehr zwiespältige Rolle gerät. Indem die Kultur zum einen festlegt, welche Regeln die Menschen bei der Ausübung ihrer Sexualität einzuhalten haben, und zum anderen ihrer Aggressionsneigung Schranken auferlegt, macht sie sich natürlich ziemlich unbeliebt. FREUD schreibt:
»Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität, sondern auch der Aggressionsneigung des Menschen so große Opfer auferlegt, so verstehen wir es besser, daß es dem Menschen schwer wird, sich in ihr beglückt zu finden. Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, da er keine Triebeinschränkungen kannte. Zum Ausgleich war seine Sicherheit, solches Glück lange zu genießen, eine sehr geringe.«10Die Behauptung mit dem Urmenschen, der es besser gehabt habe, dürfen wir dabei durchaus in Frage stellen; ich werde darauf noch zurückkommen. Aber richtig ist natürlich, daß die menschliche Kultur den Menschen Beschränkungen auferlegt. Noch einmal FREUD:
»Schon die erste Kulturphase, die des Totemismus, bringt das Verbot der inzestuösen Objektwahl mit sich, vielleicht die einschneidendste Verstümmelung, die das menschliche Liebesleben im Laufe der Zeiten erfahren hat. Durch Tabu, Gesetz und Sitte werden weitere Einschränkungen hergestellt, die sowohl die Männer als die Frauen betreffen. [...] Dabei benimmt sich die Kultur gegen die Sexualität wie ein Volksstamm oder eine Schichte der Bevölkerung, die eine andere ihrer Ausbeutung unterworfen hat. Die Angst vor dem Aufstand der Unterdrückten treibt zu strengen Vorsichtsmaßregeln. Einen Höhepunkt solcher Entwicklung zeigt unsere westeuropäische Kultur.«11Doch was derart unterdrückt und ausgegrenzt wird, kehrt in anderer Form zwangsläufig wieder. Die typische Art und Weise, mit diesem Haß auf die Einschränkungen, die uns durch unsere Kultur aufgezwungen sind, ist zunächst ein bekannter Mechanismus, nämlich die »Identifikation mit dem Aggressor«. Die eigenen kulturellen Regeln, die historisch gewachsen sind und deren Sinn oft genug zweifelhaft ist, werden für absolut erklärt, man identifiziert sich völlig mit ihnen. Dagegen werden alle, denen diese Regeln fremd sind, zu Feinden und zu Freiwild erklärt. Das folgende Statement ist O-Ton, bei einer Wahlkampfkundgebung Haiders aufgenommen:
Frau: »... Und verschmutzt ist alles, so verdreckt. Und dann rauchen s' in der Schnellbahn, obwohl verboten ist. Sie haben kei Kultur, des stört mi. Und wenn ma einem sagt, se derfen net rauchen - ja, I find des stört mi - dann sagns »I nix verstehn«, aber sonst verstehn s' alles.« Mann: »Aber die Stempeln wissen s' wo s' gibt« Frau: »Ja, des wissen s'. Und se wissen au, wo s' higehn kenna, wo s' a Geld kriegn. Aber das' net rauchn dürfn, weil mir Österreicher wissn des. Und dann hat mi aner gestern netamol aussilassn aus der Schnellbahn. Der hat die Fiaß zwischen meine Fiaß gebn und hat mi net aufstehn lassn. [unverständlich] Des hat mi gstört. Ausländer. War'n sechs Ausländer und mi. Aber, net...« Mann: »Des machen nur Ausländer« Frau: »Des macht kei kultivierter Österreicher.« Mann: »Des macht kei Österreicher« Frau: »Jetzt ganz ehrlich. Ich hab nur schlechte Erfahrungen mit Ausländer.«12Der Mechanismus ist so einfach wie perfide: Zunächst einmal können wir davon ausgehen, daß Triebwünsche existieren, die nicht ausagiert werden, da sie kulturell sanktioniert sind. Die zehn Gebote sind ein ganz guter Katalog dessen, was die Menschen gerne tun würden, wenn es nicht gewisse verinnerlichte Kulturschranken gäbe, die davor Hindernisse aufbauen: Lügen, stehlen, ehebrechen, morden... Doch natürlich löst sich die Triebenergie, wenn sie durch diese kulturellen Schranken blockiert wird, nicht einfach in Luft auf, nur weil die Gesellschaft sich Regeln gegeben hat, die ihr Ausagieren verhindern. Sie sucht sich vielmehr ein anderes Objekt, auf das sie sich richten kann, und bei diesem Objekt handelt es sich logischerweise um die kulturellen Regeln selbst. Die ursprünglichen Triebregungen verwandeln sich in Haß auf die Kultur. Dies ist die erste Verschiebung, von den ursprünglichen Triebwünschen hin zum Haß auf die Kultur, die ihr Ausagieren verhindert. Doch in der Regel funktioniert dies nicht. Die kulturellen Regeln sind viel zu sehr verinnerlicht, Teil der eigenen Persönlichkeit, als daß man sie einfach abschütteln könnte. Deshalb wird dieser Haß aus der eigenen Wahrnehmung ausgeblendet und der Prozeß der Verschiebung durch einen Prozeß der Projektion ergänzt. »Die Feindseligkeit, von der man nichts weiß und auch weiter nichts wissen will, wird aus der inneren Wahrnehmung in die Außenwelt geworfen, dabei von der eigenen Person gelöst und der anderen zugeschoben.«13 Nicht wir hassen die Kultur, die uns Triebverzicht aufzwingt, sondern die anderen, die nicht unserer Kultur angehören, haben kein Verständnis für unsere kulturellen Werte. Und der Haß, den wir selbst auf unsere Kultur haben, transformiert sich so zum Haß auf die angeblich kulturlosen Anderen, die Fremden, die unsere Kultur zerstören wollen.
In der Projektion des kulturellen Rassisten ist der Fremde immer laut und frech, er stinkt und ist permanent geil, kurz: er darf alles das tun, was man selbst gerne tun würde. Und dafür beneidet und haßt man ihn zugleich. Der eigentlich absurde Witz in dieser Projektion ist natürlich, daß der Fremde keineswegs jemand ist, der von der kulturellen Einschränkungen seines Genießens befreit wäre; auch wenn sich die Regeln unterscheiden mögen, der Fremde ist seinen Regeln ebenso unterworfen wie wir den unseren. In der Tat können wir sogar die Vermutung anstellen, daß es FREUDs »Urmenschen«, der frei von allen kulturellen Einschränkungen seine Triebe ausgelebt hat, niemals und nirgendwo gegeben hat. Vielmehr entspringt die Vorstellung eines ungezügelten Genießens überhaupt erst der recht späten historischen Erfahrung, daß die kulturellen Regeln mitnichten einfach gegeben sind, sondern sich permanent wandeln und in Fluß sind.
Diese Erfahrung verstärkt die Aggressionsbereitschaft gegenüber dem Fremden. In dem Augenblick, in dem die Relativität des eigenen kulturellen Regelsystems erfahren wird, muß ein viel höheres Maß an psychischer Energie aufgebracht werden, um sich von der Gültigkeit der eigenen Ordnung zu überzeugen. Dieser erhöhte psychische Aufwand führt dann dazu, daß die Aggressionsbereitschaft denjenigen gegenüber, die als Gegner des eigenen Wertesystems ausgemacht werden steigt. Dies erklärt wahrscheinlich auch, warum der gegenwärtige deutsche Rassismus im Osten um einiges aggressiver auftritt als im Westen. Da die reibungslose Identifikation mit dem neuen Wertesystem eben nicht klappt, wird ein deutlich gesteigerten Energieaufwand benötigt, der in erhöhte Aggressionsbereitschaft umschlägt.
Damit haben wir eine psychoanalytische Antwort darauf, warum vor allem in gesellschaftlichen Umbruchssituationen Gewalt gegen die, die als die Anderen, Fremden ausgemacht werden, in erschreckendem Maße ansteigt. Und es erklärt auch, warum die kapitalistische Gesellschaftsordnung, die schon beinahe per definitionem der Umbruch in Permanz ist, einen konstanten Strom rassistischer Aggression freisetzt.
Doch dies ist offensichtlich nur die eine Seite der Medaille. Der rassistischen Ausgrenzung des anderen korrespondiert, wenn unser anfänglicher Befund stimmt, ein beinahe ebenso konstanter Strom der Aneignung des Fremden durch die Populärkultur. Wie läßt sich dies erklären?
Nun, die einfache Antwort wäre die, daß, wie eben festgestellt wurde, das Verhältnis zu den eigenen kulturellen Werten durch eine hochgradige Ambivalenz gekennzeichnet ist. Unsere Haltung der eigenen Kultur gegenüber ist geprägt durch eine Haßliebe, die, so läßt sich vermuten, sich sowohl nach der einen oder auch der anderen Seite auflösen läßt. Und so schließen sich praktischer Rassismus und Begeisterung für exotische Klänge zumindest nicht zwangsläufig aus.
Doch dies ist als Erklärung nicht hundertprozentig befriedigend. Sicherlich, wir können durchaus annehmen, daß diese Ambivalenz den uns zumindest bislang unbekannten Mechanismen zu Grunde liegen wird, die die Einheit von Rassismus einerseits und die Begeisterung für exotische Klänge andererseits ermöglicht. Doch die Ambivalenz als solche ist noch nicht per se eine Erklärung. Ich will im folgenden eine Hypothese aufstellen, die diese beiden Hälften der Ambivalenz auf unterschiedlichen Ebenen situiert und es damit erlaubt, ihre Simultaneität zumindest begrifflich zu fassen.
Dazu ist es nötig, von FREUD aus einen Schritt weiter zu gehen, nämlich zu LACAN. LACANs Lehre von den drei Ordnungen, den Ordnungen des Imaginären, des Symbolischen und des Realen, soll es uns im folgenden erlauben, die positive Rezeption des Exotismus genauer zu verstehen.
Es liegt auf der Hand, daß es die Ordnung des Imaginären ist, die für den Bereich der Exotica-Musik von ganz zentraler Bedeutung ist. Selbst wenn wir nicht genau wissen, was die »Ordnung des Imaginären« bei LACAN bedeutet, so können wir uns doch vorstellen, was damit im Bereich des Exotismus gemeint ist: Die exotische Welt, deren Bilder die Musik evoziert, ist natürlich nicht real, sondern ein Traumbild, das außerhalb eines wie auch immer erfahrenen Alltags situiert ist.
Doch geben wir uns nicht mit einer solch oberflächlichen Interpretation des Imaginären zufrieden, sondern schauen wir näher zu, inwieweit der präziser gefaßte psychoanalytische Terminus des Imaginären uns näheren Aufschluß über die psychische Funktion des Exotismus liefern kann.
Für LACAN ist die Ordnung des Imaginären eng verknüpft mit der Ich-Bildung bzw. dem Narzißmus. Schon FREUD hatte angefangen, dem »Ich«, das für die europäische Tradition mit dem Subjekt zusammenfiel, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Indem er den Menschen in verschiedene »Personen« zerlegte, das Es, das Ich und das Über-Ich, die ständig miteinander im Streit liegen, hatte er das Ich seiner uneingeschränkten Vormachtstellung beraubt. LACAN ging in dieser Hinsicht noch einen gewaltigen Schritt weiter: Das Ich (moi) ist das Resultat einer Selbstentfremdung; dort wo der Mensch am ehesten glaubt, mit sich selbst identisch zu sein, findet LACAN eine grundlegende Spaltung.
Nach LACAN ist es das sogenannte Spiegelstadium in der Kindheitsentwicklung, in der das imaginäre Ich entsteht: Das noch hilflose und noch nicht einmal seiner Gliedmaßen mächtige Kleinkind sieht sich selbst im Spiegel an und erkennt sich erstmals als ein Ganzes. Nur in dieser Entfremdung, indem sich das Kind mit einem anderen, nämlich seinem Spiegelbild identifiziert, bildet sich das Ich. LACAN setzt sich hier in ganz bewußten Gegensatz zur europäischen Tradition seit Descartes, in der das Ich als unmittelbare Selbstgewißheit aufgefaßt wurde. Bei ihm ist das Ich buchstäblich das Resultat einer Reflexion, keine Unmittelbarkeit, sondern ein Vermitteltes.
Es ist wichtig, den illusorischen Charakter dieses gespiegelten Ichs einzusehen: Das Kind, das sich mit seinem Spiegelbild identifiziert, hat selbst noch gar nichts von dieser Einheit der Person, die sich ihm im Spiegel zeigt. Es selbst beherrscht kaum seine eigenen Gliedmaßen, die ihm noch durchaus als Fremdkörper vorkommen, während ihm das Spiegelbild eine trügerische Identität vermittelt. Ja, es ist sogar in der Lage, dieses trügerische Spiegelbild zu lenken, insofern dieses allen seiner Gesten folgen muß, auch wenn diese noch so plump und unkontrolliert sind.
Dieser ursprüngliche Narzißmus, den wir im Spiegelstadium erwerben, wird uns nie mehr verlassen. Wir können dieser Falle, »Ich« zu sagen und damit uns als einheitliches, identisches Subjekt zu meinen, gar nicht entgehen. Unser imaginäres Selbstbild ist ständig wie ein übergroßer Schatten präsent, der sich immer wieder über uns legt.
Gerade in der Populärkultur wird dieser Mechanismus waidlich ausgenützt. Hier werden wir permanent mit Bildern überschüttet, die zu derartigen imaginären Identifikationen einladen. Auch wenn uns irgendwie klar ist, daß wir kein James Bond sind: In dem Augenblick, in dem wir im Kinosessel Platz nehmen und die vertraute Melodie erklingt, agiert der Held mit der Lizenz zum Töten an unserer Stelle. Und alle ironischen Distanzierungsbemühungen werden uns nicht davor bewahren, dem Zauber einer Welt zu verfallen, in der das Tötungstabu aufgehoben ist und wo hinter jeder Ecke ein schöne Frau wartet, die sich uns an den Hals wirft...
Diese Einsichten in die Grundstruktur des Imaginären scheinen einigermaßen banal zu sein. Tatsächlich haben wir aus ihr bislang nichts anderes abgeleitet als den wenig originellen Vorwurf, daß die Populärkultur eine ziemlich eskapistische Angelegenheit ist. Wenn dies alles wäre, dann könnten wir das LACANsche Brimborium getrost vergessen. Doch die Grundeinsicht, daß die Ordnung des Imaginären gerade in der Populärkultur ganz wesentliche Entsprechungen findet, daß hier vor allem das Schema narzißtischer Identifikation bedient wird, kann durch eine ganz wesentliche Charakterisierung ergänzt werden.
Es ist dies die vorsprachliche Natur des Imaginären. Der Blick ist das zentrale identifikationsstiftende Moment des Spiegelstadiums, die Sprache bleibt dabei außen vor, oder genauer: sie ist hier noch gar nicht vorhanden. Kein Wunder also, daß echte Helden lakonisch und wortkarg sind; ihr Wortschatz muß wenig mehr als »Hasta la vista, Baby!« umfassen.
Dieser Ausschluß der Sprache aus dem Imaginären spiegelt sich in der Exotica-Musik darin wieder, daß sie größtenteils Instrumentalmusik ist. In Sachen Sprachlosigkeit der Exotica-Musik schoß sicherlich KORLA PANDIT, dessen Fernsehshow bereits erwähnt wurde. Selbst als die Show auf dem Höhepunkt ihrer Popularität eineinhalb Stunden dauerte, wurde kein Wort gesprochen: Der absolute Triumph des Blicks über die Sprache. Aber selbst wo wir einen Text haben, wie bei den Capri-Fischern, dann wird normalerweise keine Geschichte erzählt, sondern es werden Bilder evoziert.
Diese Sprachlosigkeit des Imaginären ist kein Zufall. Im Phantasma, der imaginären Inszenierung des narzißtischen Ich, taucht der Andere überhaupt nicht auf. Es ist allein das narzißtische Ich, das sich eine Welt schafft, in der es selbst die Regeln definiert. Wenn die Welt des exotischen Phantasmas also mit diversen Versatzstücken aus einer vorgestellten, fremden Welt ausstaffiert wird, dann erscheint das Fremde hier nur absolut kontrolliert und in homöopathischen Dosen: Es ist eben der Mangogeschmack, der den alltäglichen Apfelkuchen veredelt.
Ihre eigentlich erklärende Kraft erhält diese Situierung des Exotismus im Imaginären jedoch erst dadurch, daß sie einer anderen Ebene gegenübergestellt wird, nämlich der Ordnung des Symbolischen. Die Ordnung des Symbolischen bei Lacan entspricht in etwa dem, was wir bei Freud als Kultur kennengelernt haben. Es ist dies die Ebene der intersubjektiven Verbindlichkeit, der allgemein gültigen Regeln. Und diese Ebene des Symbolischen folgt eben nicht wie das Imaginäre einer Logik der Bilder, sondern einer Logik der Sprache.
Logik der Sprache meint hier, daß es zwischen den einzelnen Elementen Regeln der Verknüpfung gibt, die nicht dem Belieben des Einzelnen anheimgestellt sind. Zwar sind sprachliche Systeme recht flexibel und es gibt einen schier unendlichen Reichtum möglicher Verknüpfungen sprachlicher Elemente; doch obwohl die Sprache ein menschliches Produkt ist und sich auch ständig wandelt, hat der Einzelne nur eine beschränkte Macht über das sprachliche Regelwerk. Und der Grund dafür liegt natürlich darin, daß Sprache kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Produkt ist.
Dies gilt natürlich nicht nur für die gesprochene Sprache, sondern auch Musik, insofern sie Sprache ist, also auf der »symbolischen« Ebene von Musik. Tatsächlich können wir in jedem Exotica-Stück - und ich bin sogar bereit, mich zu der Behauptung zu versteigen, in praktisch jedem Musikstück überhaupt - die LACANsche Unterscheidung zwischen dem Imaginären und dem Symbolischen wiederfinden.
Die Ordnung des Symbolischen, auch im Bereich der Musik, ist ganz wesentlich intersubjektiv bestimmt. Das Imaginäre hingegen, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist eine rein private Angelegenheit, die sich dadurch auszeichnet, das das narzißtische Ich aus dem phantasmatischen Raum seiner Selbstinszenierung alles Fremde ausschließt. Im Symbolischen hingegen, dem Reich der sprachlichen oder sprachanalogen Zeichen, ist die Macht des narzißtischen Ich gebrochen. Das Individuum muß sich der intersubjektiv verbindliche Natur sprachlicher Zeichen beugen; und dies gilt nicht nur für die gesprochene, sondern auch für die musikalische Sprache. Anders ausgedrückt: Dort wo Musik Sprache ist, läßt sie das private Phantasma hinter sich und öffnet den gesellschaftlichen Raum der Kultur.
Um das vielleicht etwas zu konkretisieren: In Bezug auf Musik stellt sich die Ebene des Symbolischen dar als die der musikalischen Gesetzmäßigkeiten. Es sind dies das Tonsystem mit seinen zulässigen Skalen und Harmonien, die Regeln der Akkordverbindung und des Melodieverlaufs, die Formgesetze für bestimmte Musikstücke und so weiter. Wenn wir von einem Stück sagen, daß es in C-Dur steht, der klassischen Liedform mit dem Aufbau aaba folgt, der Zwischenteil durch eine Mollrückung gekennzeichnet ist, immer wenn wir solche Aussagen über ein Musikstück machen, dann beziehen wir auf die symbolische Ebene.
Um einem Irrtum vorzubeugen: Die symbolische Ebene ist nicht gleichzusetzen mit den formalen Elementen. Ein C-Dur-Akkord als solcher kann sowohl »imaginär« wie auch »symbolisch« sein. Entscheidend ist nicht das musikalische Formelement, sondern seine Verknüpfung. Erst die Verknüpfung verschiedener musikalischer Elemente gemäß den gleichzeitig flexiblen und strengen Regeln der musikalischen Sprache, lädt diese Elemente auf mit musikalischem Sinn. Und dieser Sinn kann von jedem verstanden werden, der das Vokabular und die Grammatik dieser Sprache versteht.
Die imaginäre Ebene hingegen ist diejenige, die wir auch als die Ebene der musikalischen »Einfälle« bezeichnen können. Es sind dies die zusätzlich eingeschleusten Klangpartikel, die nicht zur Ordnung der musikalischen Signifikanten gehören, sondern als äußere Zutat hinzugefügt werden. An ihnen entzündet sich das exotistische Phantasma, das per se inkommunikabel ist.
Wenn also gelegentlich gemeint wird, über Musik könne man nicht reden, beziehungsweise daß das Reden über Musik den eigentlichen Wesenskern eben nicht treffen könne, dann ist genau diese imaginäre Ebene gemeint. Wo Musik allein die Funktion hat, das imaginäre Phantasma zu nähren, ist das Reden über Musik in der Tat ausgeschlossen. Nur dort, wo Musik sich selbst als ein sinnvolles, wenn auch keineswegs eindeutiges Zeichensystem darstellt, entwickelt sie eine Verbindlichkeit, die der der gesprochenen Sprache ähnelt. Und darüber läßt sich dann, auch in gesprochener Sprache, sehr gut reden. Ja, man kann selbst die effektvollen Fremdkörper, an denen sich das Phantasma entzündet, benennen; nur das Phantasma selbst muß, aufgrund seiner narzißtisch-privaten Natur, außen vorbleiben.
Wenn wir nun zu den musikalischen Elementen des Exotismus zurückkehren, sehen wir sehr schnell, wie sich dieser Dualismus von symbolischen und imaginären Elementen recht einfach wiederfinden läßt. Bei allen fünf Elementen, die oben aufgeführt wurden, habe ich darauf hingewiesen, wie wenig sie die eigentliche musikalische Struktur der Stücke berührt haben. Beim Text beziehungsweise der Person des Interpreten liegt das auf der Hand. Doch auch bei den Rhythmen, der Instrumentierung und den exotischen Skalen konnte ein merkwürdiger Dualismus beobachtet werden: Die »exotischen« Rhythmen lassen in aller Regel die zugrunde liegende Struktur des Vier-Viertel-Taktes unangetastet, wenn es sich nicht sogar um ganz gewöhnliche Standardrhythmen handelt, die nur durch exotische Instrumente aufgewertet werden. Die exotischen Instrumente selbst sind in ein Gefüge wohlbekannter Klangfarben eingebettet und setzen nur hier und da einige exotische Tupfer. Und auch bei den Skalen wurde darauf hingewiesen, daß die Harmonisierung völlig den abendländischen Regeln der Akkordverbindung folgt. Kurz und gut: Das eigentliche musikalische Gefüge, die symbolische Ebene der Musik, bleibt durchgängig erhalten.
Die eigentlichen Exotismen hingegen sind diesem Gefüge aufgesetzt. Es handelt sich um Effekte, die sich dem musikalischen Regelkanon entziehen, und die gerade deshalb in ihrem Einsatz sehr beschränkt sind. In der Regel nutzt sich ein solcher Effekt einfach ab und verschwindet wieder in der Versenkung. Die recht häufige Verwendung etwa der Sitar bei den Beatgruppen der 60er Jahre ist ein derartiges exotistisches Element, das aus der Popmusik völlig verschwunden ist. Andere Elemente hingegen erweisen sich tatsächlich als so substantiell, daß sie zu einem musikalischen Bedeutungsträger werden können und dadurch die Ebenen wechseln: von der imaginären Ebene wechseln sie auf die Ebene des Symbolischen, schreiben sich der musikalischen Sprache ein und erweitern diese. Dadurch verlieren sie allerdings ihren exotischen Charakter; sie werden zu einem sinnvollen musikalischen Element neben anderen. Auch hierfür gibt es genügend Beispiele, etwa die blue notes des Jazz oder die gängigen lateinamerikanischen Rhythmen. Inzwischen wirkt eher ihre Abwesenheit als ihre Anwesenheit befremdlich.
Wenn wir nun zur eigentlichen Fragestellung, der gesellschaftlichen Signifikanz des Exotismus, zurückkommen, dann können wir folgendes konstatieren: Der Exotismus spiegelt uns eine grundlegende Unzufriedenheit mit der gegebene symbolischen Ordnung der Musik wieder. Das von Freud konstatierte »Unbehagen in der Kultur« ist auch ein »Unbehagen in der Musik«. Der eigentlichen musikalischen Sprache steht das Individuum, um einen abgedroschenen Ausdruck zu verwenden, entfremdet gegenüber. Der Freund exotischer Musik verspürt, im Gegensatz etwa zum Hörer sogenannter »Volksmusik«, durchaus das Ungenügen der herrschenden musikalischen Ordnung, wählt aber den falschen, weil zu leichten Weg aus dieser Ordnung. Die Fessel des musikalischen Sinns, die auch den Hörer darauf verpflichtet, diesen im hörenden Nachvollzug zu rekonstruieren, wird abgeworfen, der Fluß der musikalischen Sprache wird ignoriert, während man sich die verstreuten Exotismen herausgreift und daran die eigenen, privaten Phantasien auskristallisieren läßt.
Dies erklärt nun auch, warum der bewundernde Konsum von exotistischer Musik auf der einen Seite Rassismus auf der anderen Seite überhaupt nicht ausschließen muß. Ich hatte vorhin mit FREUD den Rassismus auf das berühmt-berüchtigte »Unbehagen in der Kultur« zurückgeführt. Es sei die unbewußte Ablehnung der spezifischen kulturellen Regeln, mit deren Hilfe eine Gesellschaft das Genießen reguliert und in Schach hält. Mit dem Terminus des »Genießens« hatte ich dabei einen typisch LACANschen Terminus in die FREUD-Exegese eingeschleust. Tatsächlich kommt uns an dieser Stelle noch einmal LACANs Schema der drei Ordnungen des Realen, des Symbolischen und des Imaginären wieder zur Hilfe. An dieser Stelle kommt nun nämlich das Reale ins Spiel.
Kurz etwas zur Terminologie: Mit dem »Realen« ist keineswegs die »Realität« gemeint, ganz im Gegenteil. Das was wir tagtäglich als Realität erfahren ist im wesentlichen Symbolisch. »Real« im Sinne des Lacanschen Realen ist das Trauma, der Schock, das, was durch die symbolische Ordnung ferngehalten werden soll. Wenn wir noch einmal zu Freud zurückgehen, dann wäre das Reale das »Barbarische«, »Urmenschliche«, das von der Kultur mehr schlecht als recht gebändigt wird.
Bei Lacan hingegen ist das Verhältnis im Gegensatz zu Freud kein einfaches Ursache-Wirkungsverhältnis. Das Reale ist ihm nämlich sowohl durch die symbolische Ordnung produziert, wie es diese auch andererseits wiederum reguliert. Was mit dieser Paradoxie gemeint ist, erschließt sich einem vielleicht, wenn man das Problem versteht, das LACAN mit der Einführung des Realen zu lösen versucht. Wie bereits erwähnt, schwingen bei FREUDs Kulturbegriff immer gewisse biologistische Untertöne mit, die ihn zu einem evolutionistischen Konzept von Kultur führen: Zuerst, im Ursprung war der Mensch ein durch keinerlei Kultur reglementiertes Raubtier, das blind und brutal alle seine Triebe befriedigte, eben FREUDs berühmter Urmensch. Und erst die allgemeine Entwicklung der Kultur habe aus diesem rohen Barbaren ein halbwegs gesittetes Lebewesen gemacht, das aber jederzeit in der Gefahr steht, diese kulturelle Bändigung seiner animalischen Leidenschaften von sich zu werfen.
LACANs Schema der drei Ordnungen vermeidet diese Pseudo-Entwicklungslogik. Das System der Kultur, die symbolische Ordnung, ist nicht allein Reaktion auf die Drohungen eines präexistenten Realen, sondern es setzt, in einem streng dialektischen Sinn, seine eigene Ursache. Das heißt, das exzessive Genießen, das die symbolische Ordnung abwehrt, wird überhaupt erst dadurch produziert, daß »wir« uns, als »kultivierte Österreicher« - oder Deutsche oder Franzosen oder Engländer - von den anderen, den Fremden abgrenzen. Die symbolische Ordnung konstruiert das Reale als exzessives Genießen des anderen, der uns unser Genießen gestohlen hat. SLAVOJ ZIZEK, der momentan wohl einflußreichste Lacan-Interpret, beschreibt diesen paradoxen Sachverhalt folgendermaßen:
»Was wir verschleiern, wenn wir dem anderen den Diebstahl des Genießens zuschreiben, ist die traumatisierende Tatsache, daß wir niemals besessen haben, was uns angeblich gestohlen worden ist: Der Mangel (die Kastration) ist ursprünglich, das Genießen konstituiert sich selbst als »gestohlen« oder, um Hegels genaue Formulierung aus der Wissenschaft der Logik aufzunehmen, kommt nur zum Sein, indem es hinter sich gelassen wird.«14Die Kultur ist aus diesem Blickwinkel durchaus nicht das Bollwerk gegen die archaische Gewalttätigkeit, Rassimus ein Rückfall in ein vorkulturelles Stadium, sondern der inhärente Mangel der Kultur produziert den Rassismus, indem er dem Fremden das unterstellt, was uns durch unsere kulturellen Regeln angeblich verboten wird: Das Genießen. Und es ist nicht allein ein Genießen, sondern vor allem ein Übermaß an Genießen, das den Rassisten umtreibt. Noch einmal ZIZEK:
»Was uns wirklich am »anderen« stört, ist die befremdliche Art, wie er sein Genießen organisiert, genaugenommen das Mehr daran, der »Exzeß«, der ihm anhängt (der Geruch der Speisen, ihre »lärmenden« Lieder und Tänze, ihre seltsamen Verhaltensweisen, ihre Arbeitseinstellung).«15Dies ermöglicht es uns nun zu verstehen, warum Rassismus und eine Liebe zu Exotica-Klängen sich überhaupt nicht ausschließen müssen: Dieses exzessive Genießen des anderen, das uns traumatisiert, ist auf einer völlig anderen Ebene angesiedelt wie das imaginäre Phantasma, nämlich eben auf der Ebene des Realen, wo es in der Regel keinen Berührungspunkt gibt zum phantasmatischen Raum, in dem sich das narzißtische Ich von den Zumutungen des Symbolischen erholt.
Tatsächlich sind diese beiden Ebene in ihrem gegenseitigen Ausschluß komplementär: Beides sind sie Reaktionen auf die grundlegende Mangelhaftigkeit der symbolischen Ordnung. Im exotischen Phantasma konstruieren wir das unmögliche Genießen ohne Exzeß, von dem wir glauben wollen, daß es möglich wäre, wenn uns die Fremden nicht unser Genießen gestohlen hätten. Hier identifizieren wir uns mit einem Fremden, das keinerlei traumatisierende Qualität besitzt, das nicht einmal fremd ist, sondern nur unsere eigenen Wunschbilder reproduziert.
Das Reale der Musik jedoch ist das, was von der symbolischen Ebene von Musik tabuisiert wird, das, was an Musik schmutzig, vulgär und lärmend ist. Die musikalische Sprache unserer abendländischen Tradition konstituierte sich gerade dadurch, daß sie unerbittlich den Ausschluß insignifikanten Krachs betrieb. Die herrschende musikalische Ordnung verdankt sich einem großangelegten Versuch, alles was die Einheitlichkeit des Ton- und Klangraumes störte, zu eliminieren. Die Homogenisierung des Tonraums durch die temperierte Stimmung gehört ebenso in diesen Kontext wie die Eliminierung aller Instrumente, die den Wohlklang durch unbeherrschbare Geräuschhaftigkeit stören.
Gute Musik war sich dessen immer bewußt. Statt dem Füttern des Egos durch exotische Einsprengsel ist es die Aufgabe ästhetisch anspruchsvoller Musik, das traumatisierende Reale in der Musik selbst wieder auftauchen zu lassen. Und dies muß in Form musikalischer Elemente geschehen, die sich weder in die musikalische Logik als Bedeutungsträger integrieren lassen noch den Prozeß imaginärer Flucht aus der musikalischen Logik unterstützen. Vielmehr stehen sie in der musikalischen Faktur als irritierende Fremdkörper, als Platzhalter des Realen, die der imaginären Flucht Paroli bieten.
Wie so etwas vielleicht klingen könnte, demonstrieren ROBERT JOHNSON & PUNCHDRUNKS:
1Interview mit Martin Denny in: REsearch: Incredibly strange music, San Francisco 1993, S.143.
2Angaben nach: Der Musikmarkt: 30 Jahre Single Hitparade, Starnberg 1989 und BARDONG, DEMMLER, PFARR, Lexikon des deutschen Schlagers, Ludwigsburg 1992.
3 HEKTOR ROTTWEILER [d.i. THEODOR W. ADORNO], »Über Jazz«, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Jg.5 (1936), S. 235f.
4Interview mit Martin Denny, a.a.O., S.144.
5Steve Otfinoski, The Golden Age of Rock Instrumentals, New York 1997, S. 11.
6Vgl. z.B.: http://www.harmony-central.com/Guitar/exotic-scales.txt
7Skip Heller, Linernotes zu: Korla Pandit, Odyssey (Fantasy Records FCD-24746-2).
8Höre hierzu: ATRIUM MUSICæ DE MADRID: La Spagna (BIS CD-163 STEREO). Diese CD bietet eine ganze Reihe von Variationen aus der Zeit vom 15. bis zum 17. Jahrhundert.
9Liner Notes zu Stereo extrem - Akustische Sensationen mit den Orchestern Helmut Zacharias, Werner Müller, Dick Schory, Esquivel, Teldec Telefunken-Decca-Schallplatten, SHZT 554, [ca. 1965].
10Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt a.M. 1997, S.79.
11Ebd., S.69.
12Dokumentiert im Film Die Wahlkämpfer, aufgenommen Wien 1992.
13Sigmund Freud, Totem und Tabu, Frankfurt a.M. 1998, S.113.
14Slavoj Zizek, Mehr-Genießen. Lacan in der Populärkultur, Wien 1992, S.90.
15Ebd., S.88f.